Neurotheologie
- Matthias Reithmann

- 6. Mai 2025
- 4 Min. Lesezeit

1. Einleitung
Die "Neurotheologie" (auch "Neuronale Theologie" ) ist ein interdisziplinäres Forschungsfeld, das die Wechselwirkungen zwischen neurologischen Prozessen und religiösem Erleben untersucht. Ihr Ziel ist es, die biologischen Grundlagen spiritueller Erfahrungen zu verstehen und deren Bedeutung für Theologie, Pastoral und Kirchenentwicklung aufzuzeigen. Sie bringt Erkenntnisse der Hirnforschung, Psychologie und Theologie miteinander ins Gespräch, etwa wenn neuropsychologische Studien zur Wirkung von Meditation in pastoralen Konzepten für spirituelle Bildung integriert werden. Daraus ergeben sich wertvolle Impulse für die Weiterentwicklung der Seelsorge, Glaubenskommunikation und religiösen Bildung, wie zum Beispiel durch die Integration neurobiologischer Erkenntnisse in die Gestaltung kontemplativer Gottesdienste, die Entwicklung spiritueller Kursangebote in der Erwachsenenbildung oder die Zusammenarbeit mit wissenschaftlich orientierten Einrichtungen wie dem Zentrum für Spiritualität und Neurowissenschaften in Tübingen.
Die Neurotheologie eröffnet einen reflektierten Zugang zu Fragen wie: Was passiert im Gehirn, wenn Menschen beten, meditieren oder eine religiöse Vision erleben? Welche neurobiologischen Strukturen sind beteiligt, wenn sich Menschen transzendentale Wirklichkeiten erschließen? Und wie lassen sich diese Erkenntnisse pastoral fruchtbar machen, ohne den Glauben auf reine Neuromechanismen zu reduzieren?
2. Wissenschaftliche Grundlagen von Neurotheologie
Im Zentrum der neurotheologischen Forschung steht die Frage, wie spirituelle Erfahrungen auf neuronaler Ebene ablaufen. Dabei kommen moderne bildgebende Verfahren wie funktionelle Magnetresonanztomografie (fMRT) oder Positronen-Emissions-Tomografie (PET) zum Einsatz. Diese Methoden ermöglichen es, bestimmte Hirnregionen während religiöser Praktiken sichtbar zu machen.
Zentrale Erkenntnisse:
Der Temporallappen ist maßgeblich beteiligt an mystischen Erfahrungen und spirituellen Visionen. Bei religiös motivierten epileptischen Anfällen wurde häufig eine Aktivierung in diesem Bereich beobachtet.
Der Parietallappen zeigt während tiefer Meditation eine reduzierte Aktivität, was zu einem veränderten Raum-Zeit-Erleben und dem Gefühl der Selbsttranszendenz führen kann. Dies wird häufig als „Ich-Auflösung“ beschrieben – ein zentrales Element vieler mystischer Erfahrungen.
Der präfrontale Cortex, zuständig für Konzentration und Handlungssteuerung, wird bei intensiven spirituellen Praktiken wie dem kontemplativen Gebet besonders aktiv. Dadurch wird die Fokussierung auf das Göttliche neurologisch gestützt.
Zusätzlich wurden auch hormonelle und neurochemische Reaktionen beobachtet, wie unter anderem in Studien von Andrew Newberg dokumentiert, insbesondere ein erhöhter Ausstoß von Dopamin und Serotonin bei positiven spirituellen Zuständen. Die Neurotheologie interpretiert diese Phänomene nicht als Ersetzung des Glaubens, sondern als Teil der göttlich gegebenen menschlichen Natur.

3. Theologische Reflexion
Die Neurotheologie steht nicht im Widerspruch zur traditionellen Theologie, sondern ergänzt sie durch eine empirische Perspektive. Sie betrachtet das Gehirn als Schnittstelle zwischen Geist und Körper, durch die religiöse Erfahrungen vermittelt werden. Daraus ergibt sich eine theologische Anthropologie, die Leib und Seele in ein neues Verhältnis bringt.
Zentrale Fragestellungen:
Wie ist Gotteserfahrung naturwissenschaftlich beschreibbar?
Wie verändert sich unser Gottesbild durch neurowissenschaftliche Erkenntnisse?
Welche Bedeutung haben körperliche Rituale in Liturgie und Sakramenten aus neurobiologischer Sicht – etwa der Einsatz von Weihrauch, das rhythmische Singen von Psalmen oder das Knien im Gebet – und wie beeinflussen diese konkreten Elemente über sensorische Kanäle und motorische Muster das spirituelle Erleben?
Wie lassen sich Offenbarung, Eingebung und Gebet theologisch fassen, wenn man ihre neuronalen Korrelate kennt?
Die Neurotheologie lädt ein zu einem verantwortungsvollen Dialog zwischen Wissenschaft und Glaube. Sie trägt dazu bei, spirituelle Erfahrungen nicht zu entmystifizieren, sondern zu vertiefen. Eine Kirche, die bereit ist, sich auf neue wissenschaftliche Erkenntnisse einzulassen, wird zugleich anschlussfähig für suchende und aufgeklärte Menschen bleiben.

4. Kritische Einordnung und Grenzen
Die Neurotheologie ersetzt keine klassische Glaubenslehre, sondern erweitert deren Horizonte. In der Praxis zeigte sich dies beispielsweise in einem Pilotprojekt einer süddeutschen Kirchengemeinde, in dem Meditationseinheiten mit neurobiologisch fundierten Impulsen zur Förderung spiritueller Selbstwahrnehmung in die Firmvorbereitung integriert wurden. Der Mehrwert lag in der Intensivierung der persönlichen Gottesbeziehung und der Entwicklung einer bewussteren Gebetskultur.
Grenzen und Herausforderungen:
Reduktionismusgefahr: Religiöse Erfahrungen dürfen nicht allein auf neurochemische Prozesse reduziert werden.
Ethische Fragen: Wie gehen wir mit experimenteller Forschung an spirituellen Zuständen um? Welche Rolle spielen Freiwilligkeit und seelsorglicher Schutz?
Begrenzte Aussagekraft: Die Neurotheologie kann nicht die Wahrheit oder den objektiven Gehalt religiöser Inhalte messen.
5. Anwendung für die Gemeindepastoral
Die Erkenntnisse der Neurotheologie können in vielfältiger Weise in die pastorale Arbeit der Kirchengemeinde integriert werden. Erste Initiativen in der Diözese Rottenburg-Stuttgart zeigen, wie neurospirituell begleitete Meditationsangebote, theologisch fundierte Achtsamkeitskurse und spirituelle Impulsabende neue Zugänge zur Glaubensvertiefung schaffen können.
Anwendungsfelder:
Glaubenskommunikation: Förderung eines sprachfähigen Glaubens durch Einbeziehung der persönlichen Erfahrungsebene und der emotionalen Dimension.
Meditation und Achtsamkeit: Einführung kontemplativer Übungsformen in der Erwachsenenbildung, z. B. Exerzitien im Alltag, achtsamkeitsbasierte Eucharistievorbereitung.
Liturgiegestaltung: Gestaltung von Gottesdiensten, die gezielt Elemente der Stille, des Rhythmus und der Symbolsprache nutzen, um das spirituelle Erleben zu vertiefen.
Katechese: Aufbau eines integrativen Menschenbildes (Leib-Seele-Geist) in Firmkatechese, Ehevorbereitung und Trauerpastoral.
Dialog mit Wissenschaft: Entwicklung von Veranstaltungsformaten (z. B. Themenabende oder Gesprächsreihen), die Glauben und Neurowissenschaft in Beziehung setzen.
Schulseelsorge und Familienarbeit: Vermittlung einfacher neurobiologischer Zusammenhänge zum Umgang mit Emotionen, Angst, Stille und Resonanzfähigkeit im religiösen Kontext.
Die Gemeinde könnte diese Perspektiven gezielt aufgreifen, gestützt auf bereits bestehende diözesane Netzwerke wie das Forum Kirche & Wissenschaft, den Fachbereich „Spirituelle Bildung“ im Haus der Katholischen Kirche Stuttgart oder Modellprojekte aus dem Bereich „Kirche an besonderen Orten“, etwa durch die Gründung einer AG „Spiritualität & Neurotheologie“, durch Pilotveranstaltungen oder Kooperationen mit regionalen Bildungseinrichtungen.
6. Fazit und Empfehlung
neuronale Theologie liefert keine abschließenden Antworten, wie auch die Deutsche Bischofskonferenz in ihrem Grundtext zum Synodalen Weg (2022) betont: "Die Kirche muss bereit sein, aus neuen wissenschaftlichen Einsichten theologische Folgerungen zu ziehen, ohne vorschnell die Wahrheit des Glaubens preiszugeben." Aber sie schafft neue Denkräume für eine Kirche, die sich als lernende, suchende und dialogbereite Gemeinschaft versteht.
Für die Gemeindearbeit in St. Karl Borromäus ist sie eine wertvolle Ressource, um spirituelle Erfahrungsformen zu vertiefen, das Verständnis für die Vielfalt geistlicher Ausdrucksformen zu erweitern und die Relevanz des Glaubens in einer wissenschaftlich geprägten Welt aufzuzeigen.
Empfehlung: z. B. mögen Interessierte oder Verantwortliche erwägen, eine Arbeitsgruppe „Spiritualität & Neurotheologie“ einzurichten, regelmäßig Impulsveranstaltungen durchzuführen und die Erkenntnisse in die Liturgieentwicklung und Glaubenskommunikation systematisch zu integrieren.
Langfristig könnten kirchliche Akteure durch die Verbindung von Theologie und Neurowissenschaft beispielsweise ein interdisziplinäres Bildungszentrum für Spiritualität, Wissenschaft und Gesellschaft ins Leben rufen – etwa in Kooperation mit theologischen Fakultäten, diözesanen Akademien und medizinisch-psychologischen Instituten. Ein solches Zentrum könnte Raum bieten für Forschung, praxisnahe Bildung, spirituelle Vertiefung und gesellschaftlichen Dialog über Sinn, Glaube und neuronale Dimensionen der Spiritualität.
6. Weiterführende Literatur und Quellen
Andrew Newberg / Eugene d'Aquili: Why God Won’t Go Away, 2001.
Dr. Martin Burkhardt: https://dr-martin-burkhardt.de/neuronale-theologie/
Nomos Verlag: Neurotheologie. Hirnforscher erkunden den Glauben, 2021.
Artikelreihe in "Herder Korrespondenz", Themenheft: Gott im Gehirn? (2023).
Forschungsbericht der Universität Wien zur spirituellen Resonanzerfahrung (2022)
Diözesane Fortbildungsunterlagen (HA IV – Pastorale Konzeption, DRS)
Erstellt mit https://chatgpt.com, KirchenXpert, Neuronale Theologie Erklärung sowie https://www.afnb-international.com, Education Navigator 2.0, Billy, und die Bilder mit https://gamma.app/
Hier können Sie den gesamten Beitrag herunterladen:
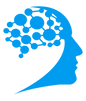



Kommentare